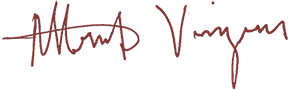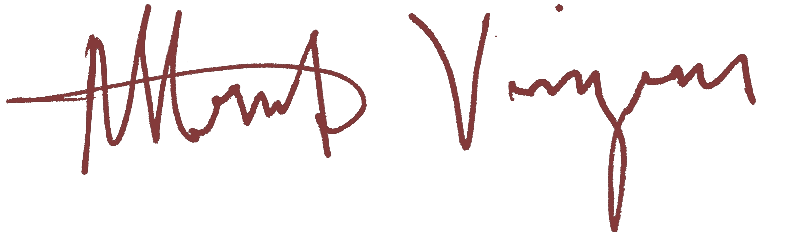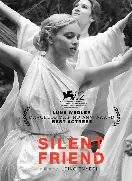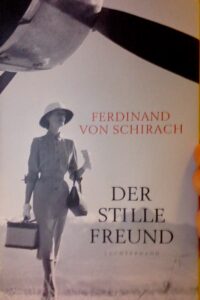«Wenn du einen Roman schreiben willst, musst du der Lokführer sein», sagte einst Erich Kästner einem Jungen, der ihn fragte, wie er denn eigentlich seine Bücher schreibe.
Lokführer*in musst du also sein, oder, an Olympia 2026 angepasst, Skifahrer*in.

Mit den Skiern kommst du am schnellsten voran, wenn du sie laufenlässt. Kanteneinsatz verlangsamt das Tempo, es braucht ihn aber, um die nächsten Kurven zu kriegen. Das optimale Verhältnis zwischen Kanteneinsatz und Laufenlassen macht den Unterschied zwischen denen, die auf dem Podest stehen und den vielen anderen.

Beim Schreiben sind es nicht die Kanten, sondern die Weichen – wie beim Zugfahren. Du musst Weichen stellen, damit deine Geschichte Fahrt aufnehmen und, im besten Fall, dahinrauschen kann wie ein TGV oder ein Albatros über den Wellen des Pazifiks.
Zu viele Weichen vermindern das Tempo und das Ziel rückt in die Fernen. Doch wenn du zu wenige oder die falschen Weichen stellst, kommt der Zug erst recht nicht an.
Ich fühle mich beim Schreiben weder als Zugführer noch als Skifahrer, sondern wie eine Mischung aus Lokomotive, die losdonnern will (die Batterien sind aufgeladen, die Maschinen auf Höchstleistung eingesetellt), und kleinem Streckenwärter, der – jedenfalls früher war das so – emsig zwischen den Gleisen hin und her rennt und blitzschnell die nötigen Weichen stellt.
Grüße und gute Wünsche, herzlich