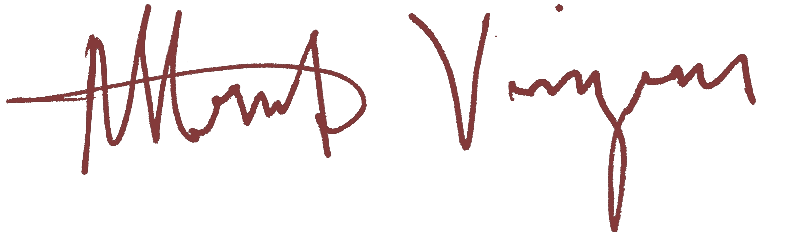Sich nicht mit Mode zu beschäftigen, ist arrogant. Mode sei ein ästhetisch bereichernder Teil unseres Alltags und definiere, zumindest partiell, wer wir seien. So zu lesen in einem Beitrag des italienischen Philosophen Andrea Baldini im Newsletter des Philosophie Magazins. Baldinis Landsmann Giacomo Leopardi hatte eine andere, nüchternere Sicht auf die Mode. Er schrieb vor zweihundert Jahren einen atemberaubenden Dialog über die Mode und den Tod.
Die Mode, seit Jahrtausenden am Haupthebel der jeweiligen Gegenwart, bereichernd, entrückend, auch erdrückend manchmal, ein Alphasystem für Omegatypen, eine Hierarchieschleuder, die Schafe als Wölfe, Langweilige als knisternde Beauties und Krumbeinige als Raubkatzen erscheinen lässt. Die Mode ist für viele so wichtig, dass sie für sie in den Tod gehen, von Schals erdrosselt werden, die sich in den Autospeichen verheddert haben, durch Lungenentzündungen wegen zu leichter Kleidung und in alle denkbaren Richtungen so weitert. Leopardi hat mehr den Blick auf den Tod, wenn von der Mode die Rede ist, während Baldini eher den typischen Italiener gibt: «Ich bin in Italien aufgewachsen, dem Mekka der Herrenmode, und dort ist es nicht unüblich, dass Männer aller Gesellschaftsschichten und jedes Alters sich förmlich kleiden.»
Es muss längst nicht mehr Italien sein. Ich war am Wochenende in Zürich. Schönstes Wetter! In den Gesichtern und Gesten, in jedem Müskelchen das große lüsterne Lechzen nach Leben – nach so viel staatlich verordneter Zurückhaltung in den letzten Monaten. Junge Männer in seidigen Röckchen, wobei ich zweimal hinschauen musste, um zu erkennen, dass es nicht doch Frauen waren. Mit ihnen spielend eine asiatische Frau mit einem schwarzen, schmalen, haardichten Schnurrbart. Augenweide, Gedankenstillstand. Dieses Grüppchen und alle anderen Männer und Frauen bewegten sich so, als würden sie im nächsten Augenblick wildfremden Leuten in die Arme springen, um von ihnen der letzten Kleiderreste entledigt zu werden. So gingen Massen von Alpha- und Omega-Menschen durch die Straßen, eine Art Karneval von Rio, allerdings ohne Tanz und Spielraum, vielmehr todernst. Die durch die Mode inszensierte Leichtigkeit des Seins macht immer leichter und leichter und immer schwerer und schwerer, gleichzeitig und total. Ich wäre am liebsten als Drohne durch Zürcher Bahnhofstraße geschwebt, leise surrend, um schnell die Position zu ändern und von oben und unten, von hinten und vorn alles gleichzeitig mit den Augen einzuverleiben.
Stattdessen rannte ich so schnell wie ich konnte von der Trambahn über den Asphalt – es ging mit Maske und schwerem Rucksack nur unter Mühen – zum Gleis 13, damit ich den Zug mit Zugbindung erwischte. Mein Sprint über den unteren Teil der Bahnhofstraße war, wie die Mode selbst, ein beinahe tödliches Geschäft, denn ich hatte über rote Ampeln zu hetzen, Leuten auszuweichen, Uhren miteinander zu vergleichen und punktgenau in der letzten Sekunde die engen Treppchen in den ICE zu überwinden. Den vielen aus Modeheften entflohenen Modeoriginalen, den Hautangeboten, den Zwischengeschlechtern, den durchscheinenden Kleidern, die weder in ihrer Funktion noch in ihrer Zuordnung als Kleidungsstücke leicht erkennbar waren, all diesen doch so wichtigen Dingen des ästehtischen Alltags konnte ich gar nicht die ihnen gebührende Aufmerksamkeit schenken. Das passt zu dieser Straße, das schenkt man sich auch sonst nichts.
Gruß,