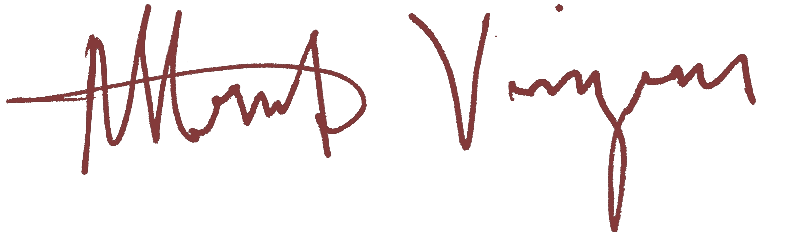Wieviel Intimität braucht ein Fototermin? Diese Frage hatte ich heute beim Fotoshooting. Zwischen der Linse und mir tausend Wände. Das Ich kommt nicht durch, nicht die Seele, nicht die Gedanken. Meine Lippen bilden einen Wall gegen die Kamera. Sie starrt, bereit alles zu erfassen, was es von mir zu erfassen gibt. Das nützt nichts, die Falten ziehen sich zurück, der Atem kommt zum Erliegen, es will nicht, ich will nicht, obwohl ich will.
Sehe, wie das bei den anderen nur so flutscht, Zahnreihen blitzend im Morgenlicht, der strahlende Tag durch die Linse ins Innere des Geräts strömend, jedesmal als wärs das erstemal, ohne Anstrengung. Das Haar wie natürlich im Wind, die Haut entspannt und die Körperhaltung ebenso.
Nicht so bei mir, eher wie bei Andy Warhol, nur ohne sein gestyltes Outfit, also seelisch nackt und, was das Endergebnis des Fotos betrifft, unterernährt. Wie doch ganz anders geht es mit mir ab, wenn ich vor dem Spiegel stehe. Allein. Nur allein.
Es gibt sie auch heute noch, die Eingeborenen, die den offenen Blick in eine Kamera scheuen wie den Blitz, der im Bambusrohr neben ihnen einschlägt. Die ersten Ethnologen kamen deshalb auf die Idee, den Blick der Kamera umzulenken. Sie taten so, als hätten sie etwas irgendwo in der fernen Landschaft im Auge, schauten aber um die Ecke und indirekt auf ihre Opfer, die scheuen Eingeborenen, und in ihre offenen Gesichter. So müsste ein Fotograf mit mir auch verfahren, nur so hätte er eine Chance, mich unverkrampft vor der Linse zu haben.
Oder er müsste ein Diane Arbus sein, die so viel Intimraum mit sich und den Opfern aufbaute, dass das Drücken auf den Knopf der Kamera zur totalen Nebensache geworden war.
Nie wieder Fotoshooting, sage ich mir heute und grüße, herzlich