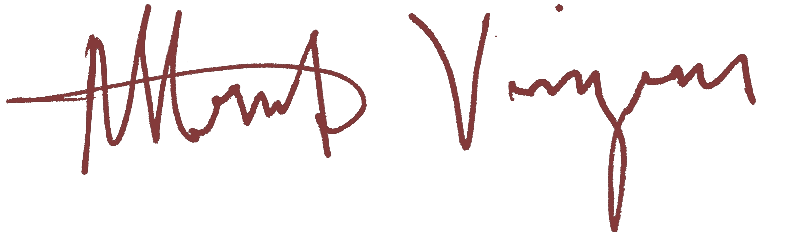Leiden, das ist ein dreifaches Teekesselchen, mindestens.
«Das große Leiden, Zeitgenosse zu sein», das ist der eigentliche Grund meines heutigen Tagesgedanken. Da gibt es viel zu leiden, jedenfalls für mich.
Dann kann ich jemanden gut leiden, einfach von Herzen mögen – wenn wir uns sehen, geht die Sonne auf.
Und dann gibt es Leiden, eine Stadt in Holland, schönste Innenstadt; bald dürfen wir wohl wieder hin und uns dort als Touristen die Beine vertreten und uns die Bäuche vollschlagen.
Zurück zu meinem Leiden. Nicht nur ein großes Leiden erfahre ich angesichts meiner Zeitgenossenschaft, sondern auch Scham, Unvermögen, Schmerz. Wie dieses alles zeigen? Ohne dass es runterzieht? Nicht die anderen und nicht mich? Wie keine Mördergrube der eigenen Scham sein, wenn es in der Seele brüllt wegen all der Ungerechtigkeit, Dummheit, Vermessenheit, Verwüstung um mich herum? Wie darüber hinweg sehen, dass Du Dich (vermutlich) kein bisschen von mir unterscheidest, der ich am Artensterben, an der Vergiftung der Luft und des Wassers leide, mein Leben jedoch im Schatten noch schlimmerer Täter so eingerichtet habe, dass ich mich subjektiv für bescheiden halten darf, während ich objektiv ein solches Luxusleben führe, dass dadurch die Welt, in der Summe hochgerechnet, in genau dem Zustand ist, in welchem sie mittlerweile ist.
Wie sein Leiden, seine Wunde zeigen? Sicher nicht, indem wir uns schulterklopfend auf Beuys und seine Werke berufen – in diesem Jahr melden sich alle gleichzeitig zu Wort, nicht gerade einvernehmlich, das wenigstens nicht, aber alle tun (nach meiner ungenauen Beobachtung) so, als wären sie mit diesem Mann, der immerhin seine Wunden zu zeigen gelernt hat (wenn wahrscheinlich auch nicht alle), persönlich intim und vom Kunst- und Gesellschaftsverständnis her mit ihm mindestens auf gleicher Höhe gewesen. Reden über die klugen Menschendinge (über die er, bei aller Liebe, auch schon ziemlich klug daherzureden verstand), das genügt nicht mehr, endlich genügt das nicht mehr.
Ich bin auf der Suche nach denen, die keine Sprache mehr haben. Dass ich hier einigermaßen verstehbar von einer Not und unerfüllten Suche schreibe und mein Leiden als Zeitgenosse auch ein Stück weit beschreiben, sagen wir andeuten kann, täuscht nicht über die Tatsache einer großen Wortlosigkeit hinweg, nicht wirklich, nicht für die die noch lesen können.
Die Wortlosigkeit selbst ist mein Leiden nicht. Dass ich nicht mehr große, ja manchmal gar keine Worte habe, ist eher mein stilles Einverständnis in eine allgemeine Not und mein bereitwilliges Zugeständnis an die Gegenwart der Menschheit, die zu einem so unendlich leidvollen Monstrum geworden ist. Mit diesem Einverständnis und Zugeständnis kann ich einigermaßen versönlich in die Welt schauen.
Auch heute herzlich,